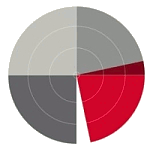Einführung
Bürgerkriege erschüttern die Grundlagen des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Mit dem Ende des Kalten Krieges, dem Zerfall nationalstaatlicher Souveränität und der Professionalisierung transnationaler Terrornetzwerke hat die traditionelle Auseinandersetzung um die Macht im Staate in der Gegenwart neue blutige Erscheinungsformen angenommen. Die Anzahl von Bürgerkriegen hat sich in den vergangenen zwanzig Jahren verringert, aber ihre Auswirkungen erreichen heute die Zentren der westlichen Welt.
Insbesondere in Staaten, die nicht in der Lage sind, ein politisch legitimiertes und rechtlich festgeschriebenes Gewaltmonopol auszuüben, drohen verfeindete Gruppierungen, die kulturellen wie institutionellen Grundlagen für Rechtssicherheit, ökonomischen Wohlstand und demokratischen Meinungsaustausch auf lange Sicht zu zerstören.
Die oft verworrenen Hintergründe von Bürgerkriegen führen zu der Frage nach angemessenen Reaktionen: Wie ist der Konfliktdynamik von Gewalt und Gegengewalt zu entkommen? Wie können traumatisierte Opfer und Täter einen Weg zurück zu einem friedlichen Zusammenleben finden? Soll die Weltgemeinschaft in Krisenregionen eingreifen, um ethnische Säuberungen und Massenmord zu verhindern? Können religiös oder ethnisch bedingte Konflikte überhaupt durch Dritte gelöst oder wenigstens gemildert werden? Sind die reichen Nationen bereit, sich dafür nachhaltig zu engagieren, auch wenn dies viel Geld kostet und das Leben ziviler und militärischer Helfer in Gefahr bringt? Oder dienen die Interventionen des Westens nur der Absicherung wirtschaftlicher Interessen und so einem Kolonialismus in neuer Form?
Die Tagung behandelt diese Fragen aus den Blickwinkeln unterschiedlicher wissenschaftlicher Disziplinen. Mit ihr nimmt der Exzellenzcluster „Kulturelle Grundlagen von Integration“ an der Universität Konstanz offiziell seine Arbeit auf. Im Cluster arbeiten Historiker, Soziologen, Philosophen, Literaturwissenschaftler, Politikwissenschaftler und Rechtswissenschaftler zusammen. Gemeinsam mit weiteren international renommierten Forschern, Diplomaten, UNO-Mitarbeitern und Publizisten diskutieren sie am 29. und 30. November 2007 im ehemaligen Dominikanerkloster in Konstanz, dem ersten Standort der 1966 gegründeten Reformuniversität und heute genutzt als Inselhotel.
Zur Eröffnung der Tagung am Donnerstagabend spricht der israelische Philosoph Avishai Margalit. Er hat an der Jerusalemer Hebrew University gelehrt und ist derzeit George F. Kennan Professor of International Studies am Institute for Advanced Study in Princeton. Margalit setzt sich mit den grundlegenden weltanschaulichen Voraussetzungen von Gewalttaten und der Wirkung gewaltverharmlosender wie gewaltrechtfertigender Ideologien auseinander.
Am Freitagmorgen folgt ein Vortrag des amerikanischen Politikwissenschaftlers Stathis N. Kalyvas, dessen Buch „The Logic of Violence in Civil War“ innerhalb kurzer Zeit zu einem Standardwerk wurde. Kalyvas gibt einen Einblick in die Mikrodynamik von Gewalt und benennt die nach wie vor offenen Fragen, die sich der Bürgerkriegsforschung stellen.
Die Konstanzer Wissenschaftler Aleida Assmann, Ulrich Gotter, Anna Blank und Albrecht Koschorke widmen sich im weiteren Verlauf des Vormittags der narrativen Verarbeitung von Gewalt in politischen Erzählungen und kollektiven Erinnerungspraktiken. Der Soziologe Bernhard Giesen und der Psychologe Thomas Elbert referieren über die traumatisierenden Auswirkungen von Bürgerkriegen auf die involvierten Opfer und Täter. Dieser Abschnitt der Tagung bietet ein besonders breites Spektrum unterschiedlicher wissenschaftlicher Ansätze und Forschungsmethoden zum Thema.
Am Freitagnachmittag spricht der US-Diplomat Michael Johnson, früherer Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs für das ehemalige Jugoslawien in Den Haag und heute Berater des Generalstaatsanwalts von Afghanistan. Er setzt sich mit den Schwierigkeiten der Strafverfolgung bei massiven Menschenrechtsverletzungen auseinander und geht auf die Frage ein, welche kulturellen Hindernisse dem Aufbau einer rechtstaatlichen Gerichtsbarkeit in gewaltzerrütteten Gesellschaften entgegenstehen können.
Die Tagung schließt mit einer Podiumsdiskussion zur Frage nach der Notwendigkeit und Rechtfertigung humanitärer Interventionen der Vereinten Nationen in Krisenregionen. Das einleitende Referat hält Hans Blom, bis vor kurzem Direktor des Niederländischen Instituts für Kriegsdokumentation und Leiter der Regierungskommission zur Untersuchung des Massakers von Srebrenica im Juli 1995. Es diskutieren ferner Christopher Daase, Professor für Internationale Politik an der Ludwig-Maximilian Universität München, Hubert Kleinert, Professor für Politikwissenschaft an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung des Landes Hessen und ehemaliger Bundestagsabgeordneter von Bündnis 90/Die Grünen, sowie Peter Schumann, langjähriger UNO-Mitarbeiter und zuletzt Leiter der UN-Mission im Süd-Sudan (UNMIS). Die Diskussion wird moderiert von dem Journalisten und Balkanexperten Matthias Rüb.Verantwortlich für die wissenschaftliche und organisatorische Planung sind der Konstanzer Politikwissenschaftler Wolfgang Seibel, die Historikerin Sabina Ferhadbegović und der Kulturwissenschaftler Sven Sappelt.