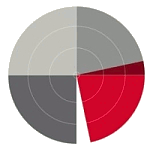Tagungsbericht
Wie entstehen Bürgerkriege? Wie werden sie begründet? Wie ist der Konfliktdynamik von Gewalt und Gegengewalt zu entkommen?
Mit seiner Auftaktveranstaltung „Bürgerkriege: Gewalt. Trauma. Intervention“ stellte sich der Konstanzer Exzellenzcluster „Kulturelle Grundlagen von Integration“ erstmals einer breiten Öffentlichkeit vor.
Das Thema war programmatisch gewählt, denn der unscharfe und polarisierende Begriff des Bürgerkriegs bot die Möglichkeit, nicht nur alle wissenschaftlichen Disziplinen des Clusters zu Wort kommen zu lassen, sondern auch Experten, die mit der Praxis der Bürgerkriegsprävention und -intervention vertraut sind.
Die Kompromisslosigkeit politischer Sektierer

Eröffnet wurde die Konferenz mit einem Vortrag des israelischen Philosophen Avishai Margalit (Institute for Advanced Study, Princeton) über das Sektierertum. Margalit skizzierte das Bild des politischen Sektierers, der sich hauptsächlich durch die Ablehnung des Kompromisses charakterisiere: Seine Wertorientierung beruhe auf einer religiösen Vorstellung von Politik; entsprechend seien heilige Werte nicht verhandelbar. Im Kontext des sektiererischen Bürgerkrieges verhindert diese Kompromisslosigkeit einen Ausgleich zwischen den verfeindeten Gruppen.
Gerade die Bereitschaft zum Kompromiss, so Margalit, sei aber entscheidend für den Zusammenhalt einer Gesellschaft, was er am Beispiel Israels darlegte.
Die Grausamkeit in irregular wars
Zu Beginn des zweiten Konferenztages erörterte Stathis N. Kalyvas (Yale University) die Logik der Gewalt in Bürgerkriegen. Oft werden Letztere mit besonderer Grausamkeit und Radikalität geführt. Laut Kalyvas hängt dies mit der besonderen Dynamik von irregular wars zusammen, wobei die Beziehung zwischen zentralen und lokalen Akteuren, zwischen Kombattanten und Nicht -Kombattanten sowie der Grad an Stabilität, den ein Kriegsakteur den Zivilisten garantieren kann, eine entscheidende Rolle spielen. Die Gewalterfahrung transformiere die Identität, so Kalyvas. Da kollektive Strategien, individuelles Verhalten und politische Vorlieben während des Bürgerkriegs ummodelliert würden, sei es unzulässig, die Ursachen extremer Brutalität in Bürgerkriegen kulturell, ideologisch oder politisch zu begründen.
Im Panel I „Gewalt erinnern und erzählen”, das sich an Kalyvas' Vortrag anschloss, standen Narrative und damit die Frage nach der Verarbeitung von Gewalt in politischen Erzählungen sowie kollektive Erinnerungspraktiken im Mittelpunkt des Interesses.

Identitätsstiftende Erzählungen von Gewalt
Ulrich Gotter (Universität Konstanz) nahm die Funktion der brutalen Erzählungen vom römischen Bürgerkrieg in den Blick und suchte nach Gründen für die stabile Relevanz des Themas in der römischen Erinnerungskultur. Nach Gotter markierte die „Ästhetik des Schreckens“ die Dimension der politischen Illegitimität, die der Bürgerkrieg in der römischen Vorstellung hatte. Gleichzeitig habe das als furchtbar re-imaginierte „Menetekel des Gemetzels“ einem Regime, das unter einem monarchischen Vorzeichen stand und somit dem Normensystem der Republik widersprach, die Legitimation verschafft.
Aus einem anderen Blickwinkel, so Gotter, sei die Erinnerung an den Bürgerkrieg „ein wichtiger Baustein zur glaubhaften Viktimisierung des römischen Adels im Verhältnis zum römischen Monarchen“ gewesen. In diesem Kontext habe sie einer negativen Identitätsstiftung der politischen Klasse Roms gedient.
Die Funktion aktueller Kriegssemantiken
Wie die Bürgerkriege erzählt werden, berichteten Albrecht Koschorke und Anna Blank (Universität Konstanz). Nach Koschorke hänge das davon ab, wie man die Ursachen von Bürgerkriegen erkläre. Anhand zweier komplementärer Modelle beschrieb er, welche Erzählweisen vom Krieg sich durchsetzen, welche Funktion sie jeweils übernehmen, wie sie Sinnzusammenhänge stiften und Identifikationsmuster entwerfen.
Am Beispiel von Sarajevo, das vor dem Bosnienkrieg für seine multiethnischen, multireligiösen und multikulturellen Traditionen bekannt war, zeigte Blank, wie ethnonationale Kriegssemantiken neue kulturelle und soziale Dispositionen hervorbringen und zur Konstruktion von ethnisch determinierten Identitäten beitragen.
Erinnern und Vergessen
Aleida Assmann (Universität Konstanz) thematisierte die Last der Vergangenheit und analysierte das Problem ihrer Überführung in Erinnerung. Assmann schlug drei mögliche Lösungen vor, damit umzugehen: 1) vergessen, 2) erinnern, um nicht zu vergessen und 3) erinnern, um zu vergessen. Das Vergessen habe sich in der Geschichte als ein Heilmittel insbesondere nach symmetrischen Gewaltverhältnissen bewährt.
Nach einer asymmetrischen Beziehung extremer Gewalt scheitere diese Strategie. In diesen Fällen sei die historische Wahrheit das Einzige, was wieder herstellbar sei; dies erfordere außerdem eine „öffentliche Politik der Reue und Anerkennung von Leid“: Es werde erinnert, um nicht zu vergessen und um eine Erinnerungskultur zu schaffen. Wenn die Erinnerung eine therapeutische und reinigende Funktion als Mittel zum Vergessen gewinnt, wird sie zu einem wichtigen Medium, um die Last der Vergangenheit abzutragen: wir erinnern uns, um zu vergessen.
Psychologische und neurologische Folgen von Gewalterfahrungen

Mit dem Vortrag „Organisierte Gewalt, reorganisiertes Gehirn und desorganisierte Gesellschaft“ eröffnete Thomas Elbert (Universität Konstanz) das zweite Panel zum Thema „Traumata von Opfern und Tätern“. Detailliert schilderte er, welche psychologischen Konsequenzen der traumatische Stress mit sich bringt, wie sich die drastischen Erfahrungen extremer Gewalt auf die Psyche der Opfer auswirken und sogar deren Gehirnstruktur und -funktion verändern. In der Folge seien die Menschen nicht mehr in der Lage, am sozialen Leben teilzunehmen. Als Methode der Kriegsführung angewandt, zermürbe das gezielte und systematische Verbreiten von Angst und Schrecken unter den Zivilisten nicht nur Individuen, sondern zerstöre soziale Grundlagen von Gesellschaften.
Umso bedeutender sei es, individuelle Traumata zu verarbeiten: Die Überwindung der Traumata hänge ganz wesentlich davon ab, ob es den Opfern gelinge, das Erlebte in Worte zu fassen, darüber zu erzählen und auf diese Weise zu einer klaren Differenzierung zwischen Vergangenheit und Gegenwart zu gelangen.
Der Umgang mit kollektiven Traumata
Der Soziologe Bernhard Giesen (Universität Konstanz) lenkte die Aufmerksamkeit auf Kollektive und betonte, dass sie ähnlich wie individuelle Personen „in ihrem öffentlichen Diskurs mit dem Zusammenbruch kultureller Selbstverständlichkeiten konfrontiert werden“ und dies als traumatisch erfahren. Entlang einer Skizze des kollektiven Tätertraumas der Deutschen, das nach seiner Meinung einer Trauma-Sequenz folge, illustrierte er seine These: erst nach einer Zeit der Latenz und Verleugnung, einer Zeit der Abspaltung, war das Aussprechen und Verarbeiten möglich. Erst nach einer Phase des „kommunikativen Schweigens“, einer Rhetorik der Dämonisierung der NS-Herrschaft und der Individualisierung der Schuld, war mit den nachfolgenden Generationen die Zeit gekommen, als Nation Verantwortung für die Verbrechen zu übernehmen, die im Namen der Gemeinschaft verübt wurden.
Die internationale Gemeinschaft und der Aufbau rechtsstaatlicher Ordnung
Welchen Beitrag der Aufbau rechtsstaatlicher Strukturen für das friedliche Zusammenleben von traumatisierten Opfern und Tätern leisten kann und welche Aufgaben in diesem Prozess die internationale Gemeinschaft übernehmen soll, erläuterte der frühere Chefankläger des Internationalen Gerichtshofs für das ehemalige Jugoslawien Michael Johnson. Eindringlich sprach er sich dafür aus, in Nachkriegsgesellschaften sowohl für den Frieden als auch für die Gerechtigkeit zu sorgen, um das Vertrauen der Betroffenen nicht zu verspielen.
Sein Vortrag und die anschließende Podiumsdiskussion verdeutlichten, welche brisanten Fragen die Forderung nach einer angemessenen Reaktion der internationalen Staatengemeinschaft auf die Bürgerkriege aufwirft. Versagt die Staatengemeinschaft in Krisenregionen, weil sie sich zu stark an das Souveränitätsprinzip hält? Unter welchen Bedingungen sind Interventionen gerechtfertigt? Gewinnt eine wertgestützte Außenpolitik im Vergleich zu einer interessengestützten Außenpolitik an Bedeutung?

Hans Blom, u.a. Leiter der niederländischen Regierungskommission, die das Massaker von Srebrenica untersuchte, eröffnete mit seinem Impulsreferat die Podiumsdiskussion. Er kritisierte die „muddling through“ Taktik der internationalen Gemeinschaft und forderte künftig klare Mandate für die UN-Einsatztruppen.
Unter der Moderation des langjährigen Balkankorrespondenten der F.A.Z., Matthias Rüb, diskutierten neben Blom die Politikwissenschaftler Christopher Daase (Universität München) und Hubert Klein (Fachhochschule für Verwaltung des Landes Hessen) sowie Peter Schumann, langjähriger UNO-Mitarbeiter und zuletzt Leiter der UN-Mission im Süd-Sudan.
Fazit
Auch wenn aufgrund der Komplexität und der Vielgestaltigkeit von Bürgerkriegen nur eine Annährung an den Begriff möglich war und am Ende mehr offene Fragen als Antworten standen, geht von Konstanz ein eindeutiges Signal aus: Das Potenzial einer weit reichenden Erforschung des Themas steht außer Frage. Diese wiederum kann nur interdisziplinär erfolgen.