Kulturen haben ihre Grenzen
Der Fall Guttenberg oder Regeln und Grauzonen in der Kultur der Wissenschaft
von Dr. Diana Schmidt-Pfister
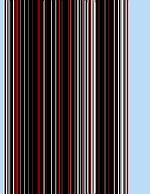
Der Fall scheint entschieden: Die Universität Bayreuth hat Karl-Theodor zu Guttenberg seinen Doktorgrad wieder aberkannt, der Politiker hat seine Ämter niedergelegt. Ist dieser Plagiatsfall ohnegleichen symptomatisch für das Ende einer glaubwürdigen Wissenschaft? Oder doch eher symptomatisch für die funktionierenden Selbstreinigungskräfte des Wissenschaftsbetriebs?
Die Wissenschaft hat eigene Umgangsformen
Kulturen manifestieren sich in tief verwurzelten Wertesystemen und Verhaltensmustern, die oft nur vage als Regeln festgeschrieben stehen und die von Generation zu Generation weitergegeben werden. Kulturen haben ihre Grenzen, auch wenn diese oft nicht ganz klar gezogen werden können. Im direkten Vergleich mit anderen Kulturen werden sie am offensichtlichsten. So bestimmt sich Wirtschaft durch ein selbstverständliches Streben nach Gewinnmaximierung. Politik dreht sich um die Durchsetzung bestimmter Entscheidungen, die für eine Gesellschaft verbindlich sind und von dieser legitimiert werden müssen. In der Medienwelt wird über möglichst aktuelle und breite Informationsvermittlung zur öffentlichen Meinungsbildung beigetragen. In der Wissenschaft wiederum geht es darum, auf kumulative und interaktive Weise Wissen zu schaffen, von dem man hofft, dass es langlebig ist, dass es in verschiedensten Bereichen unseres Daseins auf sinnvolle Weise Anwendung findet.
Wissenschaftliche Veröffentlichungen zielen weniger auf finanziellen Gewinn als vielmehr auf eine Steigerung der fachlichen Reputation ihrer Verfasser in wissenschaftlichen Kreisen. Ein großer Teil dieses Wissensschaffens wird aus Steuergeldern finanziert. All diese Aspekte verlangen es, dass es für andere Wissenschaftler, für Anwender und auch für die Öffentlichkeit jederzeit genau nachvollziehbar sein muss, wie veröffentlichtes Wissen zustande kommen konnte. Entsprechend gibt es innerhalb des Wissenschaftssystems eigene Umgangsformen, für den Umgang mit Wissensbeständen ebenso wie für den Umgang der Wissenschaffenden untereinander.
Mit den Gepflogenheiten des Wissenschaftsbetriegs nicht vertraut?
So gut sich Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg in dem kulturellen Kontext der Politik zu bewegen weiß, er überschreitet in dem Moment eine kulturelle Grenze, in dem er an einer Dissertation arbeitet. Das gilt auch, wenn er Letzteres „nur“ als Nebenbeschäftigung und in Heimarbeit tut. Möchte man sich in verschiedenen Kulturen zu Hause fühlen, kommt man nicht umhin, sich nach den je geltenden Verhaltensmaßstäben zu richten. Wusste er das nicht? Oder war er schlicht mit den Regeln und Gepflogenheiten des wissenschaftlichen Kontextes nicht angemessen vertraut?
Nur wenn man ihm Letzteres nachweisen könnte, ließe sich seine wiederholte Aussage, er habe zu keinem Zeitpunkt vorsätzlich oder absichtlich getäuscht, weiter aufrechterhalten. Doch spätestens wenn man ihm dies tatsächlich nachweisen könnte, müsste man sich fragen, ob das, was wir „gute wissenschaftliche Praxis“ nennen, in seinen Grundprinzipien in angemessener Weise an diejenigen vermittelt wird, die sich wissenschaftlich weiter qualifizieren. In erster Linie sind das alle Promovierenden. Das wäre ein großes Thema, das nicht nur die Universität Bayreuth, sondern den gesamten Wissenschaftsbetrieb bis auf weiteres beschäftigen dürfte.
Über Plagiarismus wird bestens aufgeklärt
Bei jeder Dissertation handelt es sich um eine wissenschaftliche Qualifikationsarbeit, die unabhängig von persönlichen Umständen des Verfassers den besonderen Anforderungen des Wissenschaftssystems genügen muss. Die Konturen des wissenschaftlichen Berufsethos sind nicht immer schriftlich und institutionell fixiert. Sie sind es aber schon, wenn es um Plagiarismus im Rahmen einer Dissertation geht. Das regeln die jeweiligen Promotionsordnungen. Mit seiner Art, eine Dissertation zu verfassen, verletzt zu Guttenberg Kriterien, die schwarz auf weiß festgeschrieben sind, nämlich in der Promotionsordnung der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Bayreuth.
Unter den vielen Möglichkeiten wissenschaftlichen Fehlverhaltens ist Plagiarismus diejenige, über die hierzulande bereits im Rahmen des Studiums am besten aufgeklärt wird. An Universitäten gibt es Einführungsveranstaltungen für Studierende, die in die Geheimnisse des korrekten Zitierens einweihen, und selbst Seminararbeiten müssen in der Regel mit einer entsprechenden schriftlichen Erklärung versehen werden.
Universitäten gehen mit Fehlverhalten eher lax um
Als die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) im Jahr 1998 ihre Empfehlungen zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis herausgab, waren alle deutschen Universitäten dazu angehalten, Ombudsstellen und Kommissionen für die Prüfung von Verdachtsfällen einzurichten. Sie sollten auch schriftliche Richtlinien zum Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten herausgeben, die Fehlverhalten selbst definieren. Letztes umfasst in den meisten Universitäten Falschangaben, Plagiarismus und Sabotage von Forschungsarbeiten anderer.
Es ist dennoch anzunehmen, dass der tatsächliche Umgang mit Fehlverhalten an vielen Universitäten eher lax gehandhabt wird. Lehrende und Professoren im Unibetrieb sind vielbeschäftigte Menschen, die Studierenden- und Promovierendenzahlen steigen, die Literaturbestände wachsen ins Unermessliche und die Omnipräsenz von Wissen im Internet tut ihr Übriges. Es ist daher einigermaßen nachvollziehbar, wenngleich nicht entschuldbar, dass es oft schlicht an der Zeit fehlt, eben diese Umgangsformen bei jeder einzelnen schriftlichen Arbeit genau nachzuvollziehen. Eine ehrenwörtliche Erklärung verkommt zum Verwaltungsakt.
Spätestens die Öffentlichkeit deckt Plagiate auf
Ebenso sehr nachvollziehbar wie wenig entschuldbar ist der Umstand, dass Universitäten kein Interesse daran haben, einen Verdachtsfall in ihrem Hause ans Licht geraten zu lassen. Er begründet sich in dem komplexen Wechselspiel zwischen Reputation, Mittelknappheit und Wettbewerb um die besten Studierenden und Forschenden. Kommt es nicht zu einem Rechtsstreit oder zur Aberkennung eines Titels, bleiben daher Fälle von wissenschaftlichem Fehlverhalten oft in den Mauern einer Universität und werden durch die hausinternen Gremien geklärt.
Immerhin ist bei Plagiatsfällen und Datenfälschungen die Chance, dass diese in die Öffentlichkeit, zumindest die wissenschaftliche, geraten, am größten. Hier sind weitere Kontrollmechanismen am Werk. Eine Dissertation muss in ihrer Endversion der kritischen Prüfung zweier Gutachter, die sich mit dem Thema und der entsprechenden Literatur am besten auskennen sollten, sowie eines kollegialen Gremiums standhalten. Wird sie veröffentlicht, kommen weitere prüfende Institutionen wie Redaktionen, Begutachtungsverfahren und die kritische Leserschaft hinzu.
Letztere war es, die in Form eines Fachkollegen zur Aufdeckung des Plagiats in Guttenbergs Buch verholfen hat. Das ist nicht unüblich. Viele Fachverlage vor allem im nichtnaturwissenschaftlichen Bereich gestehen ein, dass Fälschungen und Täuschungen äußerst selten vor der Veröffentlichung aufgedeckt werden. Lediglich angesichts des ungeheuerlichen Ausmaßes, in dem plagiierte Textteile die veröffentlichte Dissertation zu Guttenbergs durchsetzen, muss man sich in diesem Fall wundern, warum dieses Werk alle der zuvor genannten Hürden problemlos und sogar mit Bravour passieren konnte!
Aufatmen wegen der neuen Möglichkeiten kritischer Prüfung?
Glücklicherweise haben das Aufkommen elektronischer Plagiaterkennungssysteme und nicht zuletzt Google in jüngerer Zeit dazu beigetragen, Plagiate mit relativ wenig Arbeitsaufwand aufdecken zu können. Wenn sich weder zu Guttenberg noch sein Doktorvater in den letzten Jahren hauptamtlich am Universitätsbetrieb beteiligt haben, kann es gut sein, dass beiden diese technische Neuerung entgangen war. Dass auf dieser Grundlage ganz neuartige Formen von kritischer Prüfung entstehen können, konnte aber niemand absehen. Spontane Initiativen wie das GuttenPlag-Wiki und einige Blogs bedeuten nicht nur eine grundsätzliche Änderung im Verfahren, welches der alleinigen Zuständigkeit der Fachexpertise enthoben wird, sondern stellen auch die Betroffenen unter nie dagewesenen öffentlichen Druck. Dass die Bayreuther Universität sich zur Bekanntgabe eines Urteils bewegen ließ, obwohl das interne Prüfungsverfahren noch läuft, ist ein überdeutliches Zeichen.
Angesichts der Bandbreite dieser Regeln und Instrumente ist man versucht, beruhigt aufzuatmen. Allerdings wird man es im wissenschaftlichen Arbeitsalltag immer mit immensen Ermessensspielräumen und vielerlei Grauzonen zu tun haben. Zum einen lassen sich nicht alle Formen wissenschaftlichen Fehlverhaltens so gut fassen, wie die des Plagiarismus und der Fälschung. Auch sind zahlreiche andere Aspekte wissenschaftlichen Arbeitens nur schwer nach „korrekt“ oder „nicht korrekt“, „gut“ oder „schlecht“ zu beurteilen. So werden als zentrale Maßstäbe für gutes wissenschaftliches Arbeiten oft Originalität, Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit genannt. Die Begriffe machen deutlich, dass es nicht nur um den Prozess des Forschens und um dessen Produkte, sondern auch um die Person des Forschers geht.
Diese Erkenntnisse beruhen auf einer aktuellen Studie zu wissenschaftlicher Integrität, die die Autorin in hochrangigen Universitäten in Deutschland, Großbritannien und den USA durchführt. In dieser Hinsicht ist es vielleicht am beruhigendsten zu wissen, dass es in der Wissenschaftskultur trotz allen Misstrauens und aller Skandale auch solche gibt: leidenschaftliche Forschende, die sich dafür begeistern, ihre wissenschaftliche Arbeit aus freien Stücken allermindestens „gut“ zu machen. Nachweislich, wenngleich aus bisher ungeklärten Gründen.
Dr. Diana Schmidt-Pfister forscht im Exzellenzcluster „Kulturelle Grundlagen von Integration“ an der Universität Konstanz zum Thema wissenschaftliche Integrität.